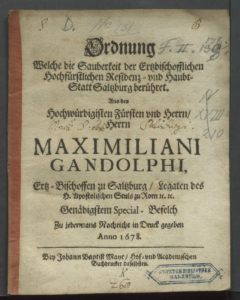LZ 127 – Ein Luftschiff über Salzburg
Auch wenn es nicht die Jungfernfahrt des Luftschiffs „Graf Zeppelin“ war, welche zehn Tage zuvor am 18. September über dem Bodensee stattgefunden hatte, so konnte man von einer frühen Probefahrt sprechen, welche das Starrluftschiff mit der Kennung LZ 127 unternahm, als es am 28. September 1928 im Luftraum über der Stadt Salzburg erwartet wurde.
Einem neuen Luxusdampfer vor dessen Einfahrt in den Hafen gleich, warteten tausende von Salzburgern auf dieses Ereignis. Manch Schaulustige auf der Spitze des Gaisberg meinten den Zeppelin bereits erblickt zu haben, kaum dass dieser den Luftraum der Bayerischen Landeshauptstadt München verlassen hatte. Bei herbstlichen Wetterbedingungen die den Blick gerade Mal bis zum Chiemsee erlaubten, ein Ding der Unmöglichkeit. Das Salzburger Volksblatt schrieb am Folgetag: „Alles wartete gespannt auf den Kanonenschuss von der Festung Hohensalzburg, der die Ankunft des Luftriesen signalisieren sollte. Endlich, um 9 Uhr 47 Minuten, fielen zwei Signalschüsse. Gleichzeitig war der Zeppelin über den nördlichen Teisenberg-Ausläufer sichtbar geworden. Er stand zu diesem Zeitpunkt quer gegen Salzburg, um dann entschieden Richtung auf die Grenze zu nehmen.“[1]
Aber nicht nur Schaulustige verfolgten das Spektakel. Postkartenverlage schickten ihre Fotografen zu den besten Aussichtspunkten oder setzten sie auf den Rücksitz eines Flugzeugs, nur um die schönsten Aufnahmen vom Überflug zu bekommen. Mit Bildpostkarten oder Sammelbildern von Zeppelinflügen ließ sich damals Geld verdienen.
Die Aufregung der Salzburger war verständlich, denn auch wenn andere Luftschiffe schon seit Jahrzehnten den Himmel überquerten, so war dieses Schiff in jeglicher Hinsicht beeindruckender, egal ob in Aussehen oder Größe. Es waren die Folgen des Großen Krieges, die die Welt so lange auf diesen Riesen der Lüfte haben warten lassen.
Die Niederlage der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg führte dazu, dass die Entwicklung von Luftschiffen in Deutschland für fast ein Jahrzehnt nicht vorangetrieben werden konnte. Dabei waren die Techniker und Ingenieure rund um Ferdinand Graf von Zeppelin (1838-1917), dem Begründer des Starrluftschiffbaus, über viele Jahre weltweit führend. Schon früh bürgerte sich länderübergreifend für jegliche Art von zigarren- bzw. zylinderförmigem Luftschiff die Bezeichnung Zeppelin ein, auch wenn diese streng genommen nur für die von der Zeppelin-GmbH. gebauten Typ des Luftschiffs galt. Selbst der adelige Erfinder, der sein erstes Modell LZ 1 (LZ für Luftschiff Zeppelin) im Sommer 1900 einige Male über dem Bodensee aufsteigen ließ, nannte seine Luftschiffe Zeppeline. Dieser Bekanntheitsgrad und der sich mit den Jahren einstellende Erfolg waren hart erarbeitet und nicht wenige zweifelten zunächst an den Visionen des Grafen. Nach einer Serie von Unfällen mit seinen frühen Modellen wurde er im Volksmund oft als „der Narr vom Bodensee“ bezeichnet und selbst Kaiser Wilhelm II. nannte ihn noch 1899 den „Dümmsten aller Süddeutschen“[2]. Die sich einstellenden Erfolge ab 1900 änderten die Einschätzung von Volk und Kaiser rasch und bereits 1901 verlieh Wilhelm dem Grafen einen Orden wegen seiner Verdienste um die Luftschifffahrt.
Trotz steigender Popularität bleib die Finanzierung der Luftschiffe zunächst das größte Hindernis, das es zu überwinden galt. Bereits beim zweiten Luftschiff konnte der Bau nur durch Spendengelder sowie eine von Zeppelin im Jahre 1906 veranstaltete Lotterie bewerkstelligt werden. Gleiches galt zunächst für die nachfolgenden Schiffe LZ 3 und LZ 4, wobei letzteres eine unverhoffte Wendung bei den finanziellen Problemen herbeiführen sollte. Nachdem mit steigender Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit der Zeppeline das Interesse innerhalb des deutschen Militärs geweckt war, erwarb die Heeresleitung zunächst LZ 3 und kündigte auch den Kauf von LZ 4 an, sollte dieser für eine 24-Stunden-Fahrt geeignet sein.
Bei dieser Fahrt am 5. August 1908 kam es aufgrund eines Motorschadens und eines Gewittersturms zunächst zu einer Notlandung und später durch Gasentzündung zu einem Totalverlust des Schiffes. Dieser Rückschlag, der eigentlich das wirtschaftliche Aus für den Luftschiffbau bedeuten hätte müssen, führte zunächst unter den tausenden Zuschauern des Unglücks und später im ganzen Deutschen Reich zu einer einmaligen Spendenaktion, bei der mit der gesammelten Summe von 6 Millionen Mark (ca. 35 Millionen Euro) der Grundstein für die Luftschiffbau Zeppelin GmbH sowie der noch heute existierenden Zeppelin-Stiftung gelegt werden sollte. Somit konnten in den folgenden Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 21 weitere Luftschiffe mit der Kennung LZ 5 bis LZ 25 fertiggestellt werden, von denen einige bereits für den kommerziellen Transport von Fahrgästen verwendet wurden. Die deutsche Militärführung erwartete lange Zeit einen hohen strategischen Nutzen von den Luftschiffen, weshalb sie zu Kriegsbeginn die Weiterentwicklung der Technik forcierte, was zum Bau von 88 Kampfluftschiffen innerhalb der ersten drei Kriegsjahre führte. Mit der Niederlage des Deutschen Reichs endete auch die Luftschifffahrt, denn der Vertrag von Versailles forderte im Rahmen der Reparationsleitungen explizit die Auslieferung aller verbliebenen Luftschiffe, der Luftschiffhallen und der Anlagen für die Herstellung des Traggases.
Graf von Zeppelins Nachfolger Hugo Eckener (1868-1954), der schon lange die friedliche als die militärische Nutzung favorisiert hatte, versuchte unter großen Schwierigkeiten die Bestimmungen von Versailles zu umgehen und baute zwei kleinere Zivilluftschiffe, LZ 120 und LZ 121, welche allerdings 1921 auf Forderung der Siegermächte an Italien und Frankreich auszuliefern waren.
Die kurze Blütezeit der mondänen Luftschifffahrt sollte ausgerechnet mit einem Auftrag eines ehemaligen Kriegsgegners beginnen, denn der Umstand, dass die Vereinigten Staaten von Amerika selbst kein funktionstüchtiges Schiff zu bauen vermochten, veranlasste diese den Auftrag an die Zeppelin-GmbH zu vergeben, die 1924 das Luftschiff LZ 126 oder das Amerikaluftschiff fertigstellte. Zwar erhielt man in Friedrichshafen kein Geld für das Schiff, da es von den USA mit den Reparationskosten verrechnet wurde, aber es war der Wiedereinstieg in den kommerziellen Zeppelinbau und die Vorlage für das Luftschiff Graf Zeppelin, welches knappe vier Jahre später zum ersten Mal über Salzburg hinweggleiten sollte.
LZ 127 war über 236 m lang, 30,5 m breit und sein Traggasvolumen von 105.000m3 machten es zu einem wahrlichen Giganten der Lüfte, der mit 5 Maybach-Motoren, einer Gesamtleistung von 2850 PS sowie einer Höchstgeschwindigkeit von 128 km/h etwa 12.000 km am Stück zurücklegen konnte. Mit durchschnittlich 45 Mann Besatzung und 25 Gästen, die für die an Bord herrschenden Platzverhältnisse in wahrem Luxus reisten, wurde LZ 127 zum erfolgreichsten Luftschiff aller Zeiten. Durch 1,7 Millionen unfallfreie Kilometer bei 590 Fahrten, 139 Atlantiküberquerungen nach Nord- und Südamerika, 34.000 transportierten Passagieren, hält das Luftschiff Graf Zeppelin noch heute Weltrekorde für Luftschiffe aller Klassen.[3]
Hugo Eckener stand selber am Steuer, als LZ 127 in den Morgenstunden des 28. September 1928 abhob um eine Tagesreise von Friedrichhafen am Bodensee über München und Salzburg nach Wien und zurück zu unternehmen. Das Wetter war zunächst schlecht und noch auf dem Weg nach München war nicht klar, ob der Zeppelin die Grenze zur Alpenrepublik überhaupt überqueren würde. Das Wetter wurde jedoch zusehends besser und knapp vor 9 Uhr verließ der Zeppelin den Luftraum von München in Richtung Salzburg, wie es den Radiosendungen der bayrischen Landeshauptstadt zu entnehmen war. Ein mitreisender Journalist schrieb: „München ist in zwei großen Schleifen umrundet, Deutsches Museum, Oktoberfestwiese, Rathaus – durch das Motorensummen des Luftschiffes hindurch hörten wir den Jubel der Münchner. „Graf Zeppelin“, von einer Staffel Flugzeuge der Verkehrsfliegerschule Schleißheim ein Stück begleitet, nimmt Kurs nach Süden, die Berge werden größer, näher – Salzburg!“[4]
Das Luftschiff flog um 10 Uhr 6 Minuten von Nordwesten her in einer Höhe von 700 m in einer großen Schleife über Lehen, Elisabethvorstadt, Schallmoos, Kapuzinerberg, Nonntal, Leopoldskron und Maxglan. In der Stadt standen tausende in den Fenstern, auf Balkonen, Dächern und Plätzen und winkten dem Koloss zu, während dieser von dem winzig wirkenden Flugzeugs des Salzburger Flughafens umkreist wurde. Keine 10 min später verließ der Zeppelin die Stadt in Richtung Braunau am Inn. Im Vergleich zu den späteren Reisen von LZ 127, die das Schiff einmal um die Welt (1929), nach Moskau (1930) ins Polargebiet (1931) oder viele Male nach Nord- und Südamerika brachten, war der Salzburgbesuch eine vergleichsweise unspektakuläre Reise, doch diente sie in der Erprobungsphase dem Erkenntnisgewinn. Einerseits musste das Schiff mit widrigen Wetterbedingungen wie Starkregen und Windböen fertigwerden, andererseits wurde erstmalig „Blaugas“ zum Antrieb der Motoren verwendet und dessen Wirken bei verschiedensten Manövern zufriedenstellend getestet. Schwachstellen in Konstruktion und Technik mussten gefunden werden, wollte man das Schiff doch baldigst im Liniendienst nach Nord- und Südamerika einsetzen.
Es waren nur wenige Minuten, die das Luftschiff über dem Himmel von Salzburg zu sehen war, doch sollte es nicht bei diesem kurzen Besuch bleiben. Bereits im Mai 1929 sowie in den beiden Folgejahren war der graue Riese wieder über der Mozartstadt zu sehen.
Mit dem Jahre 1933 begann der Nationalsozialismus in Deutschland seinen Schatten auf die Luftschifffahrt zu werfen und die kurze Blütezeit ging langsam zu Ende. Die Nationalsozialisten sahen in den Luftschiffen eine überholte Technik, die es zu Gunsten der Flugzeugtechnik nicht weiter zu fördern galt, doch erkannten sie sehr wohl die propagandistische Wirkung der weltbekannten Fluggeräte. Als der Nachfolger von LZ 127 im März 1936 über Salzburg erschien, trug er neben dem Schiffsnahmen „Hindenburg“ und der Kennung LZ 129 bereits das Hakenkreuz an den Leitwerken und von Zeit zu Zeit wurden Propagandafahrten unternommen, bei denen das Volk aus der Luft mit Marschmusik und Naziparolen beschallt wurde.
Das Ende für LZ 127 und den weiteren Großluftschiffen kam plötzlich und unerwartet. Die noch existierenden Zeppeline wurden nach Kriegsbeginn 1940 verschrottet, um, so das Reichsluftfahrtministerium, an kriegsnotwendiges Aluminium für die Luftrüstung zu gelangen. Ein Wiederaufleben des luxuriösen Reisens in Großluftschiffen wurde in den 1950ern kurz angedacht, konnte aber bis zum heutigen Tage nicht realisiert werden.
[1] Salzburger Volksblatt, Nr. 233, 28.9.1928, S. 7
[2] Wolfgang Meighörner: Der Graf 1838-1917, Gessler Verlag, Friedrichshafen, 2000, S. 7
[3] Bock/Knauer: Leichter als Luft: Transport- und Trägersysteme, S. 33
[4] Salzburger Volksblatt, Nr. 233, 28.9.1928, S. 7